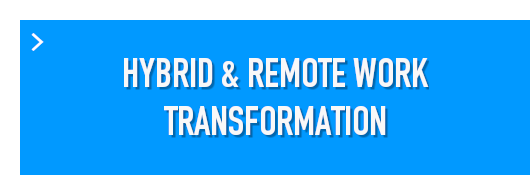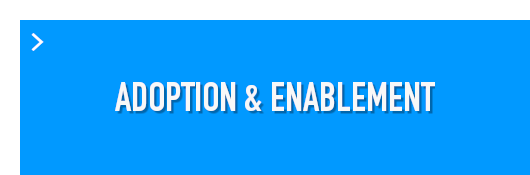Diese Woche starten wir unsere Interview-Reihe mit den Antworten von Simon Dückert, seines Zeichens Geschäftsführer der Cogneon GmbH, Initiator des erst vor Kurzem zu Ende gegangenen Management 2.0 MOOC und als Beiratsvorsitzender des Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. (GfWM) ein aktiver Teil der deutschen Knowledge Management Community.
Diese Woche starten wir unsere Interview-Reihe mit den Antworten von Simon Dückert, seines Zeichens Geschäftsführer der Cogneon GmbH, Initiator des erst vor Kurzem zu Ende gegangenen Management 2.0 MOOC und als Beiratsvorsitzender des Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. (GfWM) ein aktiver Teil der deutschen Knowledge Management Community.
In Beratungsprojekten beschäftigt er sich mit Themen rund um Lernende Organisationen, Wissensmanagement und Enterprise 2.0.
Wo stehen wir beim Thema “Social Collaboration/Business” in Deutschland?
In der Wahrnehmung der Entscheider in Unternehmen wird das Thema des Einsatzes sozialer Medien wohl hauptsächlich noch im Bereich der Vertriebs- und PR-Unterstützung sowie des Recruitings gesehen. Die Ansätzer sozialer Medien in den Intranets stecken - abgesehen von einigen Avantgardisten - zumeist noch in den Kinderschuhen. In den wenigsten Fällen haben interne Plattformen den Status einer "geschäftskritischen" Lösung erreicht, die in der Wahrnehmung aller Stakeholder ohne größere Produktivitätsverluste nicht mehr wegzudenken ist.
Was sind die Herausforderungen für 2014?
Bisher wird die Geschichte der sozialen Medien noch zu oft aus der Ecke der technischen Funktionalitäten (Tools und Knöpfe) oder der Übertragung aus dem Internet (Corporate Facebook, Corporate Wikipedia, Corporate YouTube) erzählt. Wir sollten die Geschicht umdrehen und darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen Unternehmen und deren Mitarbeiter heute stehen, z.B. stegiger Wandel, Innovationsdruck, Globalisierung, Volatilität, Demografischer Wandel, Komplexität und Informationsflut. Dann können wir darüber nachdenken, ob diese Herausforderungen durch Prinzipien wie Offenheit, Partizipation, Gemeinschaft, Selbstorganisation, Glücklicher Zufall, Meritokratie, Zusammenarbeit, Dezentralisierung, Experimentierfreude, Geschwindigkeit und Vertrauen angegangen werden können. Wenn ja, wird sich die Rolle der sozialen Medien und deren Nützlichkeit quasi von alleine ergeben. Wenn nicht, braucht das jeweilige Unternehmen sie auch nicht.
Was sollte der Beitrag einer Social Business-Diskussion auf der CeBIT 2014 sein?
Neben den typischen Beitragenden auf derartigen Veranstaltungen, den Anbietern und den Case-Ownern fände ich mal eine weitere Personengruppe spannend: Mitglieder des mittleren oder gehobenen Managements, die über Probleme in ihrer täglichen Praxis in ihrer eigenen Sprache berichten. Daraus könnte man ableiten, ob Änderungen in Führungs-, Kommunikations- und Zusammenarbeitsmustern diese Probleme an der Wurzel packen können. Somit könnte man die Geschichte der sozialen Medien aus der Sicht und mit der Sprache der Entscheider in Organisationen erzählen.
Vielen Dank für das Interview Herr Dückert!
Wir legen großen Wert auf sachliche und unabhängige Beiträge. Um nachvollziehbar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen unsere Inhalte entstehen, geben wir folgende Hinweise:
- Partnerschaften: Vorgestellte Lösungsanbieter können Partner oder Sponsoren unserer Veranstaltungen sein. Dies beeinflusst jedoch nicht die redaktionelle Auswahl oder Bewertung im Beitrag.
- Einsatz von KI-Tools: Bei der Texterstellung und grafischen Aufbereitung unterstützen uns KI-gestützte Werkzeuge. Die inhaltlichen Aussagen beruhen auf eigener Recherche, werden redaktionell geprüft und spiegeln die fachliche Einschätzung des Autors wider.
- Quellenangaben: Externe Studien, Daten und Zitate werden transparent kenntlich gemacht und mit entsprechenden Quellen belegt.
- Aktualität: Alle Inhalte beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Spätere Entwicklungen können einzelne Aussagen überholen.
- Gastbeiträge und Interviews: Beiträge von externen Autorinnen und Autoren – etwa in Form von Interviews oder Gastbeiträgen – sind klar gekennzeichnet und geben die jeweilige persönliche Meinung wieder.