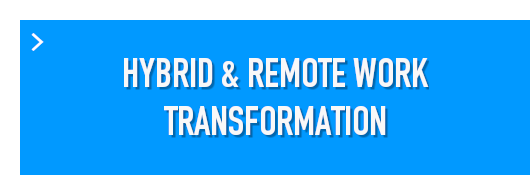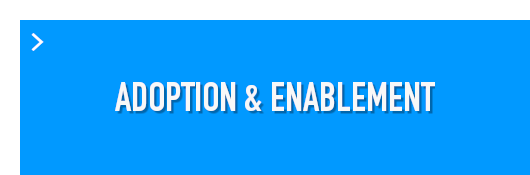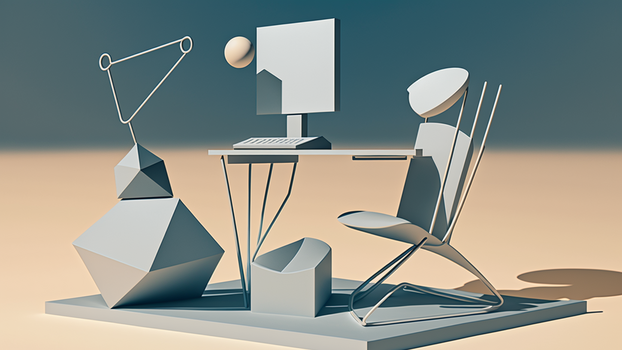
Die Frage, wann Remote Work sinnvoll ist und wann physische Präsenz im Büro notwendig wird, lässt sich heute nicht mehr pauschal beantworten. Hybride Arbeitsmodelle sind zum zentralen Gestaltungsfeld moderner Büro- und Wissensarbeit geworden. Ihre Umsetzung erfordert differenzierte Entscheidungen – abhängig von Aufgabenstruktur, Teamdynamik, technologischem Reifegrad und individueller Arbeitsweise.
Dabei ist Remote Work keineswegs ein neues Phänomen. Unter dem Begriff „Telearbeit“ existiert seit Jahrzehnten eine fundierte Forschungstradition zur ortsflexiblen Arbeitsorganisation. Die historischen Konzepte lassen sich jedoch nicht eins zu eins auf die post-pandemische Realität übertragen. Denn das, was heute unter Remote oder Hybrid Work diskutiert wird, folgt anderen Voraussetzungen, Dynamiken und Gestaltungsansprüchen.
In diesem Beitrag arbeiten wir zentrale Erkenntnisse aus der Forschungsliteratur und den organisationalen Praxisansätzen auf, um daraus ein Entscheidungsframework für den systemischen Umgang mit hybriden Arbeitsmodellen zu entwickeln. Dabei hinterfragen wir auch das gängige „Remote vs. Office“-Denken – und untersuchen, ob nicht ein flexibleres, kontextabhängiges Modell zielführender ist.
Lehren aus der Frühphase der Telearbeit: Voraussetzungen, Missverständnisse, Erkenntnisse
Ein differenzierter Blick auf heutige Remote- und Hybridmodelle profitiert von einer Auseinandersetzung mit der frühen Forschung zur Telearbeit. Bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren untersuchten Arbeitssoziologie und Organisationsforschung, unter welchen Bedingungen Arbeit außerhalb des klassischen Büros möglich und sinnvoll ist. Prominent ist hier die systematische Literaturübersicht von Bailey und Kurland (2002), die mehr als 80 empirische Studien aus verschiedenen Disziplinen – von Organisationsverhalten über Stadtplanung bis Informationstechnologie – zusammenführt.
Zentrale Erkenntnis dieser Forschung: Telearbeit wurde oft als individuelle Ausnahmelösung behandelt – adressiert auf spezielle Rollen mit stark strukturierten Aufgabenprofilen, wie in der IT, im Datenmanagement oder administrativen Support. Die tatsächliche Nutzung blieb meist auf wenige Tage im Monat begrenzt, häufig in Form informeller Arrangements. Die Frage lautete nicht: Wie gestalten wir hybride Organisationen? Sondern: Für wen ist diese Einzeloption überhaupt möglich – und unter welchen Bedingungen?
Weder reduzierte Pendelzeiten noch Familienpflichten erwiesen sich dabei als verlässliche Treiber. Vielmehr dominierten arbeitsorganisatorische Faktoren – etwa die Eignung konkreter Aufgaben für ortsunabhängige Bearbeitung, der Grad der Selbststeuerung sowie das Vertrauen der Führungskraft. Studien zeigen, dass die individuelle Wahrnehmung von Aufgaben-Eignung („perceived job suitability“) oftmals entscheidender war als formale Jobbeschreibungen (vgl. Mokhtarian & Salomon, 1997). Hinzu kamen soziale Spannungen: Während professionelle Wissensarbeiter:innen mehr Autonomie und flexible Arrangements erfuhren, verloren viele Telearbeiter:innen im administrativen Bereich an Status, Bindung und Teilhabe (vgl. Olson & Primps, 1984).
Diese frühen Studien liefern keine Blaupause für heutige hybride Arbeit. Aber sie machen einen entscheidenden Punkt deutlich: Remote Work ist kein Selbstzweck. Sie erfordert Passung – zwischen Aufgabe, Person, Team und Organisation. Genau dieser Fit ist auch im Zentrum heutiger hybrider Arbeitsgestaltung zu verorten.
Der Paradigmenwechsel: Remote Work als strukturelle Gestaltungsfrage
Mit der COVID-19-Pandemie verschob sich die Perspektive auf Remote Work grundlegend: Aus punktuellen Einzelfällen wurde innerhalb weniger Monate ein flächendeckendes Organisationsmodell. Unternehmen waren gezwungen, ihre technischen Infrastrukturen, Kommunikationsroutinen und Führungsprozesse unter Hochdruck anzupassen. Dabei wurde deutlich: Remote Work ist keine Ausnahmeoption mehr – sie ist Bestandteil einer neuen Normalität und verändert die Architektur der Wissensarbeit dauerhaft.
Diese neue Realität macht deutlich, dass die bisherigen Steuerungslogiken nicht mehr greifen. Die Entscheidung für oder gegen Remote Work lässt sich nicht länger über Rollenzuschreibungen oder pauschale Richtlinien treffen. Stattdessen braucht es kontextabhängige Entscheidungen auf Basis einer systemischen Betrachtung: Welche Aufgabe wird von wem unter welchen Bedingungen bearbeitet – und wie lässt sich dafür der passende Arbeitsmodus gestalten?
Hier knüpft der kontingenztheoretische Ansatz an: Der sogenannte Task–Environment Fit (vgl. Goodhue & Thompson, 1995) beschreibt, dass die Effektivität von Arbeitsformen maßgeblich davon abhängt, wie gut Aufgabenanforderungen, technologische Unterstützung, individuelle Fähigkeiten und Teamkontexte zueinander passen. Für hybride Arbeit heißt das: Es gibt keine ideale Lösung – nur passende Konstellationen.
In der Praxis bedeutet das: Eine kreative Konzeptionsphase mit enger Abstimmung und hoher Interdependenz kann vom direkten Miteinander im Office profitieren. Eine analytische Rechercheaufgabe mit hoher Konzentration gelingt im Homeoffice unterbrechungsfreier. Eine international verteilte Projektgruppe benötigt wiederum andere Kommunikationsmuster und technische Infrastruktur als ein lokal organisiertes Team. All das erfordert nicht nur technische und organisatorische Rahmenbedingungen – sondern vor allem ein bewusstes Arbeitsdesign.
Remote Work ist damit kein Ersatz für Präsenz – und hybride Arbeit kein Mittelweg. Beide sind Bausteine einer dynamischen Arbeitsarchitektur, deren Gestaltung an die spezifische Situation angepasst werden muss. Genau darin liegt die Herausforderung – und die Chance.
Remote oder Hybrid? Warum das "Versus" die falsche Frage ist
In vielen Debatten wird „Remote“ als Gegenmodell zum „Office“ verhandelt – als ob sich Organisationen zwischen zwei klar abgrenzbaren Zuständen entscheiden müssten. Doch dieses binäre Denken greift zu kurz. Die Realität hybrider Wissensarbeit ist fluide, kontextabhängig und oft individuell verhandelt. In der Praxis pendeln viele Teams und Mitarbeitende längst zwischen Remote- und Präsenzphasen, oft ohne formalisierte Regelung, aber mit wachsendem Bedürfnis nach Orientierung.
Diese Ambivalenz zeigt: Die eigentliche Frage lautet nicht „Remote oder Office?“ – sondern „Wann, für wen und wofür ist welcher Arbeitsmodus der richtige?“ Hybride Arbeit ist kein Kompromiss, sondern eine Gestaltungsmatrix. Sie erlaubt es, Aufgaben, Rollen und Interaktionen differenziert zu orchestrieren – entlang der Anforderungen an Autonomie, Abstimmung, Kreativität, Geschwindigkeit oder Verbindlichkeit.
Die Forschung unterstützt diese Perspektive: Duxbury und Neufeld (1999) zeigen, dass Kommunikationsmuster sich unter Telework nicht zwangsläufig verschlechtern, sondern sich vielmehr neu konfigurieren – je nach Aufgaben- und Teamstruktur. Perlow (1997) beschreibt, wie Unterbrechungen im Büro einerseits Effizienz senken, andererseits aber auch soziale Kohäsion und informellen Wissensaustausch ermöglichen. Remote Work kann Störungen minimieren, büßt dabei jedoch oft an Spontaneität und situativer Anschlussfähigkeit ein.
Diese Spannungsfelder lassen sich nicht durch ein starres Entweder-oder auflösen. Sie verlangen nach einem differenzierten Steuerungsmodell, das aufgabenbezogene Flexibilität, individuelle Arbeitspräferenzen und teambezogene Anforderungen integriert. Hybride Arbeit wird dann nicht zur Grauzone zwischen zwei Extremen – sondern zum aktiven Gestaltungskonzept.
Die Konsequenz: Organisationen sollten nicht fragen, ob sie remote oder im Büro arbeiten lassen – sondern wie sie hybride Arbeit so gestalten, dass sie wirksam, gerecht und nachhaltig funktioniert.
Entscheidungsrahmen für hybride Arbeit: Vier Dimensionen der Passung
Wenn hybride Arbeit funktionieren soll, braucht sie mehr als technologische Infrastruktur oder flexible Policies. Sie braucht Entscheidungsgrundlagen, die der tatsächlichen Komplexität moderner Wissensarbeit gerecht werden. Ein solcher Entscheidungsrahmen orientiert sich nicht an Berufsgruppen oder Präsenzquoten, sondern an den Bedingungen, unter denen Arbeit stattfindet – konkret, differenziert und systemisch gedacht.
Auf Basis der Forschung zu Telearbeit, digitalem Arbeiten und organisationalem Design lassen sich vier zentrale Dimensionen identifizieren, die als Raster für die Gestaltung hybrider Arbeit dienen können:
1. Aufgabenprofil
Nicht jede Aufgabe eignet sich gleich gut für Remote Work – und nicht jede profitiert von Präsenz. Entscheidend sind:
- Koordinationsgrad: Erfordert die Aufgabe enge Abstimmung in Echtzeit oder ist sie unabhängig bearbeitbar?
- Kreativitätsbedarf: Entsteht der Output durch individuelles Nachdenken oder kollektives Brainstorming?
- Strukturiertheit: Wie klar sind Ziele, Abläufe und Abhängigkeiten definiert?
→ Aufgaben mit hohem Fokusbedarf und geringer Abstimmungsnotwendigkeit sind ideal für Remote-Settings. Kreative, spontane, explorative Prozesse brauchen häufiger Präsenzräume.
2. Teamstruktur & Kultur
Auch die Art, wie ein Team arbeitet, prägt die Eignung hybrider Modelle:
- Vertrauensniveau: Wie ausgeprägt ist psychologische Sicherheit und Eigenverantwortung?
- Kommunikationsgewohnheiten: Gibt es etablierte asynchrone Prozesse oder dominiert spontane Interaktion?
- Verlässlichkeit & Rollenklarheit: Wissen alle, wer wofür zuständig ist und was von ihnen erwartet wird?
→ Teams mit klaren Verantwortlichkeiten und digitaler Kommunikationsroutine können ortsunabhängiger agieren. In neuen oder dysfunktionalen Teams wirken hybride Modelle dagegen oft konfliktverschärfend.
3. Individuelle Disposition
Hybride Arbeit ist nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine persönliche Frage:
- Selbstorganisationsfähigkeit: Wie gut gelingt das Setzen von Prioritäten und das Management eigener Energie?
- Technik- und Medienkompetenz: Wie souverän werden digitale Tools genutzt?
- Grenzmanagement: Wie gut gelingt die Trennung – oder Integration – von Arbeits- und Lebensbereichen?
→ Organisationen müssen keine „Typisierung“ vornehmen, aber Raum schaffen für Passung, Reflexion und Unterstützung.
4. Organisatorische Rahmenbedingungen
Schließlich entscheidet auch das institutionelle Umfeld:
- Technische Infrastruktur: Sind Tools, Zugänge und Sicherheit gewährleistet – ortsunabhängig und stabil?
- Regelwerke & Governance: Gibt es klare Leitlinien zur Verfügbarkeit, Meetingkultur und Entscheidungstransparenz?
- Lernsysteme: Werden Erfahrungen aus hybrider Praxis dokumentiert, reflektiert und weiterentwickelt?
→ Ohne strukturierende Rahmen verlieren hybride Modelle an Orientierungskraft – und verkommen zur Beliebigkeit.
Ein systematisches Zusammenspiel dieser vier Dimensionen bildet den Kern eines tragfähigen Entscheidungsrahmens. Er ersetzt nicht das situative Augenmaß, sondern schafft die Voraussetzung für reflektierte Entscheidungen. Dabei wird klar: Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Passung. Nicht um Regelbruch oder Präsenzpflicht – sondern um die bewusste Ausrichtung von Arbeit an Kontext und Ziel.
Das Führungsparadox: Wenn Entscheidungen gar nicht offen sind
Ein Entscheidungsrahmen allein reicht nicht aus, wenn die Entscheidungsrealität in der Organisation nicht offen gestaltet ist. In vielen Unternehmen ist das Zusammenspiel von Remote und Präsenz nicht Ergebnis einer reflektierten Gestaltung, sondern Ausdruck impliziter Machtverhältnisse – geprägt durch die Haltung, Routinen und Selbstverständnisse der Führungskräfte. Die Frage ist daher nicht nur: Was ist sachlich sinnvoll?, sondern auch: Was wird von Führung tatsächlich zugelassen oder blockiert?
Hybride Arbeit berührt zentrale Führungsfragen – und legt strukturelle Spannungen offen. Viele Führungskräfte sind sozialisiert in einem Kontext, der Sichtbarkeit mit Kontrolle und Präsenz mit Leistung gleichsetzt. Die plötzliche Verlagerung der Arbeit ins Digitale hat diese Gewissheiten infrage gestellt – und verlangt nach einem neuen Führungsverständnis: eines, das Vertrauen vor Kontrolle setzt, Ziele statt Zeiten bewertet und Beziehungen aktiv gestaltet, auch auf Distanz.
Doch das ist leichter gesagt als umgesetzt. Niemand ist als „hybride Führungskraft“ geboren – und viele wurden nicht darauf vorbereitet. Fehlende Rollenklarheit, Unsicherheit im Umgang mit digitaler Führung, das Ringen um Verfügbarkeit und Nähe: All das erzeugt Reibung. In der Folge entstehen widersprüchliche Signale. Offiziell gibt es Remote Policies – inoffiziell wird Präsenz eingefordert. Einzelne Teams arbeiten mobil und selbstorganisiert – andere kehren ungefragt zur Büro-Normalität zurück.
Besonders deutlich wird das dort, wo der „Return to Office“ zum autoritären Steuerungsinstrument wird. Was als kultureller Impuls oder identitätsstiftender Rahmen gemeint war, wird zur Frustrationsquelle. Nicht, weil Mitarbeitende sich der Präsenz verweigern – sondern weil die Entscheidungsgrundlagen unklar, inkonsistent oder unreflektiert sind.
Hybride Arbeit braucht deshalb nicht nur einen operativen Rahmen – sie braucht Führungskräfte, die diesen Rahmen aktiv mittragen und gestalten können. Das bedeutet: neue Kompetenzen entwickeln, alte Muster hinterfragen, Unsicherheit aushalten. Vor allem aber bedeutet es, Verantwortung abzugeben – und Raum für Passung zu schaffen. Erst dann wird aus hybrider Arbeit mehr als eine Organisationsstruktur: nämlich eine gelebte Praxis.
Die Forschung zur Telearbeit zeigt: Remote Work funktioniert nicht per se – sie muss zur Aufgabe, zur Person und zur Organisation passen. Das Gleiche gilt für hybride Modelle. Der Versuch, einfache Antworten zu geben („Remote ist besser“ oder „Wir brauchen alle zurück ins Büro“) verkennt die Komplexität moderner Wissensarbeit. Notwendig ist ein differenzierender Entscheidungsrahmen, der Aufgaben, Menschen und Organisationen zusammendenkt. Genau darin liegt die strategische Aufgabe für Unternehmen: hybride Arbeit nicht als Ausnahme, sondern als gestaltbare Normalität zu begreifen.
Fazit: Differenzierung statt Dogma – hybride Arbeit ist ein Gestaltungsprozess
Die Gestaltung hybrider Wissensarbeit ist keine Frage des richtigen Modells, sondern der richtigen Passung. Die Vorstellung, man müsse sich zwischen Remote Work oder Präsenzarbeit entscheiden, führt in eine falsche Entweder-oder-Logik. Die Realität moderner Büroarbeit ist komplexer: Sie verlangt nach differenzierten Lösungen, die Aufgaben, Menschen, Teams und Organisationen gleichermaßen berücksichtigen.
Die Forschung zur Telearbeit hat früh gezeigt, dass Remote Work kein Selbstläufer ist. Ihre Wirksamkeit entsteht nicht durch die Verlagerung des Arbeitsorts, sondern durch die abgestimmte Kombination von Aufgabenanforderung, individueller Eignung, Teamstruktur und organisatorischem Rahmen. Der Übergang in die post-pandemische Arbeitswelt hat diesen Befund nicht widerlegt, sondern verschärft. Hybride Arbeit ist heute ein strukturprägendes Element – doch sie erzeugt Reibung, wo Entscheidungsgrundlagen, Führungskompetenzen oder kulturelle Klarheit fehlen.
Ein Entscheidungsframework, das diese vier Dimensionen systematisch berücksichtigt, kann Orientierung bieten. Es ersetzt keine Führung, keine Aushandlung und keine Entwicklung – aber es schafft eine gemeinsame Sprache für die notwendige Differenzierung. Denn nicht der Modus entscheidet über den Erfolg – sondern seine Angemessenheit im jeweiligen Kontext.
Offen bleibt die Frage, wie Organisationen diesen Rahmen mit Leben füllen:
- Wie gelingt die Etablierung hybrider Prinzipien jenseits starrer Regelwerke?
- Wie lassen sich Führungskräfte befähigen, Unsicherheit auszuhalten und Vertrauen zuzulassen?
- Und wie kann die gelebte Arbeitsrealität systematisch in die Weiterentwicklung hybrider Modelle zurückgespiegelt werden?
Hybride Arbeit ist keine fertige Lösung, sondern ein Prozess. Sie verlangt Auseinandersetzung, Reflexion und kontinuierliches Lernen. Wer diese Offenheit zulässt, schafft keine Einheitlichkeit – aber eine neue Qualität in der Zusammenarbeit.
Content Newsletter
Immer über die neuesten Beiträge informiert
- Zugang zu Freemium-Inhalten der Mediathek
- Drei Credits für Freischaltung von Premium-Inhalten
- Monatlicher Content-Newsletter mit Premium-Inhalten
- Zugang zu geschlossener Linkedin-Gruppe
- Besondere Plattform-Angebote über Shift/Work Updates
- Kostenlos für immer!
Wir legen großen Wert auf sachliche und unabhängige Beiträge. Um nachvollziehbar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen unsere Inhalte entstehen, geben wir folgende Hinweise:
- Partnerschaften: Vorgestellte Lösungsanbieter können Partner oder Sponsoren unserer Veranstaltungen sein. Dies beeinflusst jedoch nicht die redaktionelle Auswahl oder Bewertung im Beitrag.
- Einsatz von KI-Tools: Bei der Texterstellung und grafischen Aufbereitung unterstützen uns KI-gestützte Werkzeuge. Die inhaltlichen Aussagen beruhen auf eigener Recherche, werden redaktionell geprüft und spiegeln die fachliche Einschätzung des Autors wider.
- Quellenangaben: Externe Studien, Daten und Zitate werden transparent kenntlich gemacht und mit entsprechenden Quellen belegt.
- Aktualität: Alle Inhalte beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Spätere Entwicklungen können einzelne Aussagen überholen.
- Gastbeiträge und Interviews: Beiträge von externen Autorinnen und Autoren – etwa in Form von Interviews oder Gastbeiträgen – sind klar gekennzeichnet und geben die jeweilige persönliche Meinung wieder.