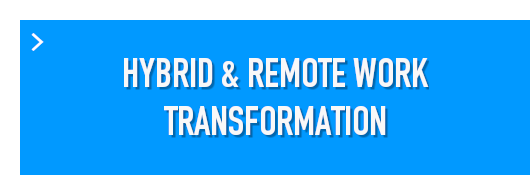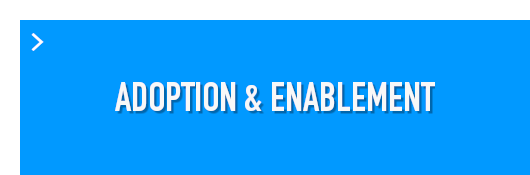Im Rahmen des IOM SUMMITs haben wir in diesem Blog bereits viel über das digitale Arbeiten und die Erfolgsfaktoren für die Einführung und Etablierung gesprochen. Der Digital Workplace als technologische Plattform ist dabei in unseren Diskussionen immer der Ausgangspunkt, weil die Plattformen der zentrale Skalierungsfaktor für die Etablierung einer unternehmensweiten Vernetzung, abteilungsübergreifenden Kommunikation und Kollaboration sowie auch für die digitale Teilhabe am Unternehmensgeschehen sind. Natürlich löst aber die Technologie alleine auch nicht das "Problem" - denn zur Etablierung und Ausschöpfung der Potentiale des "digitalen Arbeiten" braucht es auch eine individuelle, kulturelle und organisatorische Befähigung der Mitarbeiter, der Teams und der Organisation auf dem Weg zum effektvollem digitalen Arbeiten. Der Zuschnitt der Diskussion bildet dann auch den Rahmen für den i2 SUMMIT in Zürich, den wir nun auch schon seit über 10 Jahren (mit unterschiedlichen Namen und Ausrichtungen) veranstalten.
Diskussion zum Dreiklang von Toolset, Skillset und Mindset beim i2 SUMMIT
Die Technologie (Toolset) ist nicht das wirkliche Problem - aber die Befähigung zur richtigen Nutzung (Skillset) und das Verständnis für das kollaborative Miteinander (Mindset) sind es. So ist der allgemeine Tenor der Diskussionen zur digitalen Transformation der Organisation. Allerdings ist auch festzustellen, dass verschiedene Technologien (z.B. nur der Einsatz eines Enterprise Social Networks versus dem Einsatz eines sozialen Intranets oder einer Cloud-Office-Plattform à la Microsoft Office 365) ganz unterschiedliche Anforderungen an die Befähigung und dem manifestierten Verständnis für das kollaborative Miteinander mit sich bringen. Sprich unterschiedliche Technologie-Konzepte setzen unterschiedliche Anforderungen an Skillset- und Mindset-Maßnahmen. Die richtige Abstimmung der Maßnahmen für die Einführung und Etablierung zu den richtigen Zeitpunkten ist das Erfolgsrezept für die Umsetzung des Digital Workplace. Dabei gibt es natürlich nicht die eine perfekte Lösung, sondern immer nur die besondere Lösung für die Rahmenbedingungen eines bestimmten Unternehmen. Denn auch hier gilt es die unterschiedlichen Umstände und Ausgangssituationen zu berücksichtigen - mehr oder weniger stark hierarchisch geprägte Organisationskulturen, zentrale oder dentrale Organisationseinheiten, offene oder firmenpolitisch stark reglimentierte Kommunikationsumfelder. Jedes Unternehmen hat dabei seine eigenen Rahmenbedingungen, die den Weg zum "digitalen Arbeiten" sehr unterschiedlich machen.Rahmenbedingungen für digitales Arbeiten in der Schweiz
Der i2 SUMMIT ist vordererst auch immer eine Diskussion der Thematik aus Schweizer Sicht, denn neben den unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen gilt es auch die Besonderheiten des kulturellen Kontextes zu berücksichtigen. Für die Schweiz gilt es hierbei durchaus folgende Aspekte zu diskutieren:- Mehrsprachigkeit per Default - Egal ob nun im angelsächsischen Sprachraum oder im deutschen/französischen/italienischen Sprachraum - nirgendwo gibt es die Besonderheit, dass Kommunikation und Kollaboration "per default" mehrsprachig erfolgen muss. Dies ist in der Schweiz bereits für viele kleine Unternehmen der Fall, was natürlich sowohl technologisch als auch kulturell und bezgl. der Befähigungsmaßnahmen zusätzliche Anforderungen mit sich bringt.
- Schweizer Managementkultur - Konsenzorientiert, aber doch auch Erfolgsorientiert mit einer geringen Fehlertoleranz - so wird immer wieder die Schweizer Managementkultur beschrieben. Gepaart mit der besonderen Schweizer Mentalität stellt diese Situation besondere Anforderungen für das Veränderungsmanagement. Digitale Plattformen können hierbei Bremser als auch Förderer kultureller Veränderungsmaßnahmen sein.
- Besondere Infrastruktur- und Digitalisierungsinitiativen für mobiles und dezentrales Arbeiten - Mit der vom Schweizer Bundesrat in 2016 verabschiedeten Strategie "Digitale Schweiz" gibt in der Schweiz eine Besonderheit, die das "digitale Arbeiten" von Zuhause und unterwegs von staatlicher Seite als besonders förderlich - weil als allgemeiner Wettbewerbsvorteil für das Land gesehen - einstuft. Hieraus haben sich verschiedene Initiativen wie z.B. die Work Smart Initiative ergeben, die den Ausbau des mobilen und dezentralen Arbeiten aktiv fördern. Dabei ist festzuhalten, dass die Schweiz schon immer eine durchaus hohe Akzeptanz bei der Teleheimarbeit hatte, die in den letzten Jahren massiv ausgebaut werden konnte. Siehe auch die Statistik des Schweizer Bundesamtes: (Quelle)
- Ordnungspolitische Initiativen für den digitalen Kompetenzaufbau - Als weitere "zentrale Handlungsachse" der Strategie "Digitale Schweiz" wird neben der infrastrukturellen Befähigung auch der digitale Kompetenzaufbau gesehen. Hierzu wurden 2019 im Weiterbildungsgesetz unter Leitung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ein Orientierungsrahmen zu digitalen Grundkompetenzen für die Schweiz erarbeitet. Der Orientierungsrahmen des SBFI definiert fünf Handlungskompetenzbereiche, die sie als wichtige Kompetenzfelder sehen und die durch Fördermaßnahmen unterstützt werden sollen: (Quelle)
i2 SUMMIT als Erfahrungsaustausch zur Etablierung des digitalen Arbeitens im Schweizer Unternehmensalltag
Mit dem i2 SUMMIT am 07.11. in Zürich bieten wir - von Kongress Media - eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zur Etablierung des digitalen Arbeitens und der Einführung von Digital Workplace Konzepten. Entlang von verschiedenen Schweizer als auch internationalen Projektberichten diskutieren auf der Veranstaltung Praktiker und Experten über die spezifischen Anforderungen und Erfolgsfaktoren für die Einführung und Etablierung solcher Konzepte in Schweizer Unternehmen. Den diesjährigen Rahmen der Veranstaltungen stecken dabei die Vorträge von Elizabeth Marsh (Digital Work Research) sowie den internationalen Praxis-Referenten Tanja Burak (Savills) und Alex Scott (Scottish Water). Dabei geht es um die Analyse der Rahmenbedingungen zum Start des Projektes (Vortrag zum Digital Work Assement von Elizabeth Marsh), der Unmöglichkeit des "One-Size-Fits-All"-Digital Workplace Ansatzes (Tanya Burak) und dem Anwender-zentrierten Ansatz bei der Einführung des digitalen Arbeitens (Alex Scott). Darüber hinaus bietet der i2 SUMMIT zudem Schweizer Erfahrungsberichte von SIX Group, Reichle & de-Massari Holding, HG Commerciale, der Staatskanzlei Kanton Aargau und den Basler Versicherungen - sowie einer deutschen Fallstudie vom mittelständischen Unternehmen LAUDA DR. R. WOBSER. Ergänzt werden die Praxisvorträge durch verschiedene Expertenbeiträge zum digitalen Arbeiten und interaktiven Workshops. Wir freuen uns wieder auf eine spannende Diskussion und Ihre Teilnahme!Wir legen großen Wert auf sachliche und unabhängige Beiträge. Um nachvollziehbar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen unsere Inhalte entstehen, geben wir folgende Hinweise:
- Partnerschaften: Vorgestellte Lösungsanbieter können Partner oder Sponsoren unserer Veranstaltungen sein. Dies beeinflusst jedoch nicht die redaktionelle Auswahl oder Bewertung im Beitrag.
- Einsatz von KI-Tools: Bei der Texterstellung und grafischen Aufbereitung unterstützen uns KI-gestützte Werkzeuge. Die inhaltlichen Aussagen beruhen auf eigener Recherche, werden redaktionell geprüft und spiegeln die fachliche Einschätzung des Autors wider.
- Quellenangaben: Externe Studien, Daten und Zitate werden transparent kenntlich gemacht und mit entsprechenden Quellen belegt.
- Aktualität: Alle Inhalte beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Spätere Entwicklungen können einzelne Aussagen überholen.
- Gastbeiträge und Interviews: Beiträge von externen Autorinnen und Autoren – etwa in Form von Interviews oder Gastbeiträgen – sind klar gekennzeichnet und geben die jeweilige persönliche Meinung wieder.